
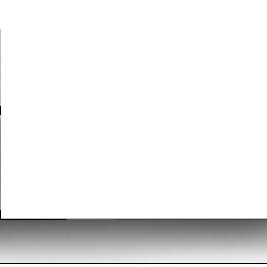

[ ... ]
Ein Blickwechsel genügt im Film, die Gefechtsformationen sauber zu sortieren. Die Frage des Schwarzen würdigt die Alte keiner Antwort; sie mustert ihn nur von oben bis unten. Der weiß nun, was er zu gewärtigen hat. Diese kurze Einstellung zeigt eindringlicher als der folgende Monolog mit seiner krassen Unverblümtheit, die lautlose Alltäglichkeit der Diskriminierung in den vermeintlich so toleranten Gesellschaften europäischer Prägung. Aus diesem Unbehagen befreit der Film durch *Lachen. Aber das Unbehagen kehrt zurück.
4 Diskriminierung im Diskurs der Medien
Die beiden hier bewußt exemplarisch im Sinne einer Projektskizze zitierten Filme könnten gegensätzlicher kaum sein. Sie markieren die Spannweite des Projekts, 'Diskriminierung im Film' zu thematisieren, ein Projekt, das einzubetten wäre in den rasant expandierenden Sektor der kritischen Diskursanalyse kontemporärer Medienkommunikation. In diesem Sektor bildet die Untersuchung von Formen und Funktionen der Diskriminierung von Minderheiten in den Medien bislang noch ein vergleichsweise schmales Segment. Empirische Analysen im Schnittfeld von Kultur-, *Kommunikations- und Medienwissenschaften, Sprach-, Literatur- und Sozialwissenschaften, Psychologie und Semiotik müßten hier das Terrain genauer ausleuchten.
Bisher lag der Schwerpunkt solcher Ansätze vor allem im Bereich der Rassismuskritik auf der Grundlage der (publizistikwissenschaftlichen, textlinguistischen, diskursanalytischen) Untersuchung von Pressetexten (Merten, Ruhrmann et al. 1986; van Dijk 1993; Jäger 1997). Inhaltsanalytische Arbeiten haben das Bild der Ausländer in der Presse herausgearbeitet (Küpfer 1994), die Asylberichterstattung kritisch unter die Lupe genommen (Hömberg & Schlemmer 1995), Stereotypen und *Metaphern auf ihren latent xenophoben Inhalt hin geprüft (Wagner 2000) und gefragt, "inwieweit einzelne Bezeichnungen (und Sprachregelungen) auf die öffentliche Meinung vorurteilsauslösend wirken" (Ruhrmann 1997: 63).
[ ... ]
Ausschnitt aus: *Migrationsdiskurs im Kurz- und Dokumentar*film Peter von Guntens They teach us how to be happy und Pepe Danquarts Schwarzfahrer
Hess-Lüttich Ernest
[...]
Wir lernten uns im Frühjahr 1955 in der Kantonsschule Schaffhausen kennen, wo wir aus zwei an entgegengesetzten Kantonsrändern gelegenen Bauerndörfern jeweils viel zu früh am Morgen mit dem Zug eintrafen und somit mehr als eine Stunde bis Schulbeginn mit Hausaufgaben und teils pubertär-philosophischen, teils nur pubertären Gesprächen verbrachten. Wir waren Beide aus der zweiten ländlichen Sekundarschulklasse in die zweite städtische Gymnasialklasse gelangt, und wir waren infolge eines bizarren Stadt-Land-Gefälles, aufgrund dessen ländlichen Schülern die Fähigkeit abgesprochen wurde, den Primarschulstoff wie die städtischen in fünf Jahren zu bewältigen, ein Jahr älter als unsere Klassenkameraden. Wir kamen zwar vom Land, waren aber keine Bauernkinder und deshalb in gewissem Masse bereits als Aussenseiter gross geworden (die ja bekanntermassen die Wahl haben, Elite oder Abschaum zu werden...). Da wir zum Mittagessen nicht nach Hause fahren konnten, kauften wir uns gemeinsam bei der Migros unser Picknick, übten dabei unseren Sinn für den optimalen Einsatz knapper Mittel für die Befriedigung grundsätzlich unbegrenzter Bedürfnisse – sozusagen als Vorgriff auf mein eigenes späteres Fach – und setzten dann unsere Gespräche fort. Dies Alles verband uns so sehr, dass wir auch im Pausenritual unzertrennlich waren; dieses bestand darin, dass wir, in Gespräche vertieft, endlose Runden um das ehrwürdige Gründerzeit-Schulhaus drehten – die Jungen in der einen und die Mädchen in der anderen Richtung, was den Gesprächen und der nonverbalen *Kommunikation einen ganz eigenen Reiz verlieh.
[...]
Ausschnitt aus: Autobiographische Notizen zu Michael *Böhler
Lutz Christian
Die Metapher als Beobachtungsform zweiter Ordnung
Hofer Stefan
