
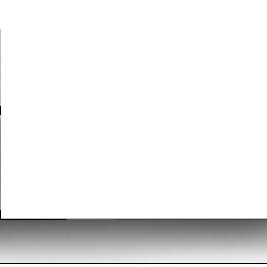

Der Stengel eines Rhizoms
Gregor Patorski
Der folgende, kurze Abriss soll ein Versuch sein, die 521-seitige Monographie von Gilles Deleuze und Felix Guattari, den Anti-Ödipus zu skizzieren und dabei den psychoanalytischen Boden unter den Füssen der Literaturwissenschaft wenigstens ins Wanken zu bringen, wenn nicht gar wegzuziehen. Von einer vollständigen Darstellung kann auf diesem begrenzten *Raum natürlich nicht die Rede sein; daher folge ich in meinen Ausführungen dem Ratschlag von Deleuze/Guattari den sie den Lesern in ihrem Buch‚Rhizom‘ geben:
"Findet die Stellen in einem Buch, mit denen ihr etwas anfangen könnt. In einem Buch gibt es
nichts zu verstehen, aber viel, womit man etwas anfangen kann." (Rhizom, S. 40)
In der Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse, auch der literaturwissenschaftlichen, taucht eine Frage immer wieder auf: Wie man denn nun Ödipus hat, wie man zu Ödipus kommt. Zuvor beziehungsweise gleichzeitig muss überhaupt geklärt werden, was Ödipus ist. Hierzu, zur Lösung dieser Fragestellung ist die Konzeption einer neuen Psychoanalyse der Schizoanalyse, wie Deleuze/Guattari sie in Gegensatz oder vielmehr Ergänzung zur Freud’schen Psychoanalyse anbieten, zu sehen. Der Hauptunterschied zwischen den beiden – wenn ich es richtig verstanden habe – ist, dass die Schizoanalyse nach dem Modus der Produktion funktioniert, die Psychoanalyse aber nach dem Modus der Repräsentation. Man merkt also: die Psychoanalyse ist sekundär: Repräsentation ist gegenüber Produktion nachgestellt.
Grob vereinfacht könnte man nun sagen, dass Ödipus diese Repräsentation ist. Ödipus repräsentiert im familialen Dreieck‚papa-mama-ich‘ im Kopf einer jeden, eines jeden von uns. Ödipus repräsentiert also das Unbewusste. Er ist es aber nicht; wie in der Psychoanalyse behauptet wird, er repräsentiert es nur. Vielmehr verdeckt Ödipus das wahre, das produktive Unbewusste. Er unterdrückt es.
"Das produktive Unbewusste räumt das Feld zugunsten eines Unbewussten, das sich nur
mehr ausdrücken kann." (Anti-Ödipus, S. 69)
Also maschinelle Produktion und nicht* metaphorische, symbolische Repräsentation (Phallus). Oder wie es Deleuze/Guattari sagen:
"Was eintritt sind Maschineneffekte, nicht Wirkungen von *Metaphern." (Anti-Ödipus, S. 7)
Was ist nun dieses schizoanalytische Unbewusste genau? In erster Linie ist es maschinell, nach Deleuze/Guattari besteht es aus Wunschmaschinen. Diese Wunschmaschinen vermögen es unendliche, in alle Richtungen ausgreifende Verbindungen herzustellen. Sie durchdringen mehrere Strukturen gleichzeitig, deshalb sind sie Maschinen. Der Wunsch als Maschine, als Wunschmaschine.
Diesen unendlichen, ausgreifenden, richtungslosen Prozess nennen Deleuze/Guattari Schizophrenie beziehungsweise Deterritorialisierung. Was wiederum eigentlich heisst, dass sich die Wunschmaschinen nicht nur auf unsere Köpfe beschränken, sondern sie durchdringen uns (als mentale Struktur) ebenso wie technische Maschinen und Gesellschaftsmaschinen (soziale Strukturen). Wunschmaschinen lassen sich nicht einpferchen.
Und doch gibt es, eine Grenze, an welcher der Prozess aufgehalten wird, eine Instanz, die die Wunschmaschinen zum Stehen bringt: Ödipus. Ein Territorium in welches der deterritorialisierende Wunsch gefangen, reterritorialisiert wird. Die Couch des Psychoanalytikers. Das familiale Dreieck‚papa-mama-ich‘, der Familialismus der Psychoanalyse, der das Unbewusste in das Gehäuse von Ödipus steckt.
Alles politische, ökonomische, gesellschaftliche, rassische wird aufs familiale runterdividiert: Ödipus ist eine gesellschaftliche Repressionsinstanz, die alles in den familiären Triangel hineinpresst. Repräsentation führt zu Repression.
Wie kommt man nun zu diesem Ödipus?, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Wie kommt Ödipus als gesellschaftliche Repressionsinstanz zustande? Die Psychoanalyse erfindet ihn ja nicht, er ist bereits vorher da. Was die Psychoanalyse hingegen tut, sie codifiziert, übersteigert, mystifiziert die Repräsentation; sie stellt sich in den Dienst der Repression.
Ödipus entsteht historisch:
GRAFIK (Rene Seite 364 unten aus dem Anti ödipus hier hineinpappen)
In Stammesgesellschaften beziehungsweise auf dem Körper der Erde bereitet er sich als leere, unbesetzte Grenze vor, als Fetisch. Auf der despotischen Maschine, im Feudal*system, bildet er sich als symbolisch besetzte Grenze; Bild/Abbildung. Im Kapitalismus, auf dem vollen Körper des Kapitals erfüllt er sich als* imaginär gewordener Ödipus, Trugbild. Ödipus ist das Resultat der universalen Geschichte. Im Kapitalismus beendet er seine Wanderung in den Tiefenelementen der Repräsentation. Er wird Repräsentant des Wunsches, fängt den Wunsch ein, die Wunschmaschinen bleiben stehen. Und wir sind ödipalisiert.
Wie lässt sich nun eine solche Gesellschaftstheorie auf die Literatur anwenden? Wie lässt sie sich für Literaturwissenschaft nutzbar machen? Bevor ich an diesen Punkt herangehen werde, möchte ich noch ein Faktum der Theorie erläutern. Der Anti-Ödipus nennt sich Kapitalismus und Schizophrenie im Untertitel. Beides sind nach Deleuze/Guattari Deterritorialisierungsprozesse, Prozesse also die unendlich um sich ausgreifen. Der eine auf der Ebene von Gesellschaftsmaschinen vermittels des Geldes, der andere auf der Ebene von Wunschmaschinen vermittels der Libido. Der Kapitalismus muss aber um seine Kapitalströme ins Unendliche deterritorialisieren zu können, die Wunschströme reterritorialisieren: Der Wunsch muss ein Ziel, einen Zweck erhalten. Hier kommt ihm die Psychoanalyse zupass und der Ödipalisierungsprozess insgesamt.
Zwischen diesen beiden Polen nun, zwischen dem ödipal-kapitalistischem und dem schizophren-libidinösen sehen Deleuze/Guattari Literatur und Kunst aufgespannt. Auf der einen Seite eine Literatur, welche ödipalisiert und ödipalisierend ist, strukturiert, reduziert auf einen Konsumgegenstand.
"Die ödipale Form der Literatur macht ihre Warenform aus." (Anti-Ödipus, S. 173)
Auf der anderen Seite herrschen die deterritorialisierenden Ströme, die den Signifikanten Ödipus zum Schweigen bringen, die die Struktur zur Ohnmacht verdammen. Literatur als Experimentieren, als Prozess ohne Sinn und Zweck, als Produktion, als Wunschproduktion. Eine solche Literatur hat das Potential ihre Leser zu deterritorialisieren, zu schizophrenisieren, das ödipale Dreieck zu sprengen, die Wunschmaschinen in Gang zu setzen, Wunschströme fliessen zu lassen, das produktive Unbewusste zu befreien, zu desödipalisieren; aus dem Familialen in die Gesellschaft: Der Primat der Gesellschaft ist wieder hergestellt. Eine Literatur in diesem Sinne erfüllt die Aufgaben der Schizoanalyse.
Zwischen dem ödipalen und dem schizophrenen Pol kann sich Literatur also bewegen. Deleuze/Guattari würden die Frage‚Gebrauchstext vs. Das was Literatur ausmacht‘ vermutlich durch dieses Modell beantworten wollen. Natürlich ist dieses Modell wertend. Sache der Literaturwissenschaft wäre es nun bei einzelnen Texten zu bestimmen, wo zwischen den beiden Polen sie zu liegen kommen. Und hierzu kann nach Deleuze/Guattari die Psychoanalyse trotzdem nützlich sein, aber nur in ihrer Selbstkritik als Schizoanalyse. Hiermit möchte ich schliessen, und hoffe, man hat mich, getreu des Mottos, nicht verstanden.
Mit diesem kurzen Text möchte ich keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass ich bei Prof. Michael *Böhler nichts verstanden habe. Nein, ich danke ihm, dass ich durch ihn Vieles angefangen habe und mit Vielem etwas anzufangen weiss.
